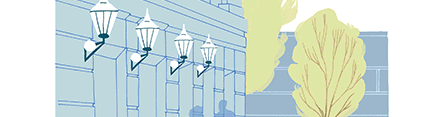Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Lektürekurs 'Kants Morallehre im Diskurs' |
| Semester | WS 2017/18 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
| Heimat-Einrichtung | Theologische Fakultät |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Montag, 16.10.2017 12:15 - 13:45 |
| Art/Form | Übung |
| Studiengänge (für) | KE/D: AM KG |
| SWS | 2 |