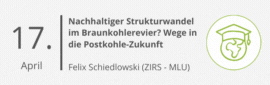Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Ü zur Vorlesung: Einführung in Wissenschaftstheorie und Forschungslogik (M1) |
| Semester | WS 2008/09 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
| Heimat-Einrichtung | SFB 580: Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Mittwoch, 22.10.2008 08:15 - 09:45, Ort: (Hörsaal A) |
| Sonstiges |
Zu den einzelnen Themenbereichen wird folgende Einführungsliteratur in einem Handapparat zusammengestellt (und während des Semesters weiter ergänzt). Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Titel sollten zu Beginn der Veranstaltung bereits gelesen worden sein. Themenbereich Wissenschaftstheorie und Forschungslogik Diekmann, A. (2008). Empirische Sozialforschung. Reinbek: Rowohlt, Kap. 1, 2, 4 (S. 18-71, 116-183) Esser, H./ Klenovits, K./ Zehnpfennig, H. (1977). Wissenschaftstheorie 1. Teubner Studienskripten. Stuttgart: Teubner, Kap. 3 u. 4 (S. 101-160). Flick/Kardorf/Steinke (Hg.) (2003). Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt, Kap. 1 und 3.5 (S. 13-29, 164-174). Giesen, B./ Schmid, M. (1976). Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie. München: Goldmann. Kelle, U. (2007). Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. * Schnell, R./ Hill, P./ Esser, E. (1999). Methoden der empirischen Sozialforschung. München: Oldenbourg, Kap. 3.1 (S. 47-83). * Thome, H. (2007). Methoden der Sozialforschung. In: Hans Joas (Hg.), Lehrbuch der Soziologie, 3. Auflage. Frankfurt: Campus; Kap. 2 (S. 39-71). Wenturis, N./ Van hove, W./ Dreier, V. (1992). Methodologie der Sozialwissenschaften. Tübingen: Francke (UTB)., Kap. 5 – 7 (S. 94-146) Themenbereich Spieltheorie Diekmann, A. (2008). Spieltheorie. Reinbek: Rowohlt (erscheint im Dezember) Themenbereich Werte und Moral Grasmick, H. G./ Bursik, Jr., R. J. (1990). Conscience, significant others, and rational choice: Extending the deterrence model. In: Law & Society Review 24, S. 837-861 Halpern, D. (2001) Jagodzinski, W. (1999). Verfällt die Moral? Zur Pluralisierung von Wertvorstellungen in Italien und Westdeutschland. In: R. Gubert/ H. Meulemann (Hg.), Annali die Sociologia – Soziologisches Jahrbuch 13/1997-I-II, Trento, S. 385-417. Homann, K. (1997). Individualisierung: Verfall der Moral? Zum ökonomischen Fundament der Moral. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B21/97, S. 13-21. Ingleharr, R. (1979). Wertwandel in den westlichen Gesellschaften: Politische Konsequenzen von materialistischen und postmaterialistischen Prioritäten. In: H. Klages/ P. Kmieciak (Hg.), Wertwandel und gesellschaftlicher Wandel. Frankfurt/New York: Campus Klages, H. (2001). Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten? In: Aus Politik und Zeitgeschichte 29, S. 7-14. Meulemann, H. (1998). Die Implosion einer staatlich verordneten Moral. Moralität in West- und Ostdeutschland 1990-1994. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50: 411-441. * Nunner-Winkler, G. (1999). Moralische Integration. In: J. Friedrichs/ W. Jagodzinski (Hg.), Soziale Integration. Sonderheft 39 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 293-319 * Thome, H. (2005). Wertewandel in Europa aus der Sicht der empirischen Sozialforschung. In: H. Joas/ Klaus Wiegandt (Hg.), Die kulturellen Werte Europas. Frankfurt: Fischer TB, S. 386-443. Thome, H. (2003). Soziologische Wertforschung. Ein von Niklas Luhmann inspirierter Vorschlag für die engere Verknüpfung von Theorie und Empirie. In: Zeitschrift für Soziologie 32, S. 4-28. |